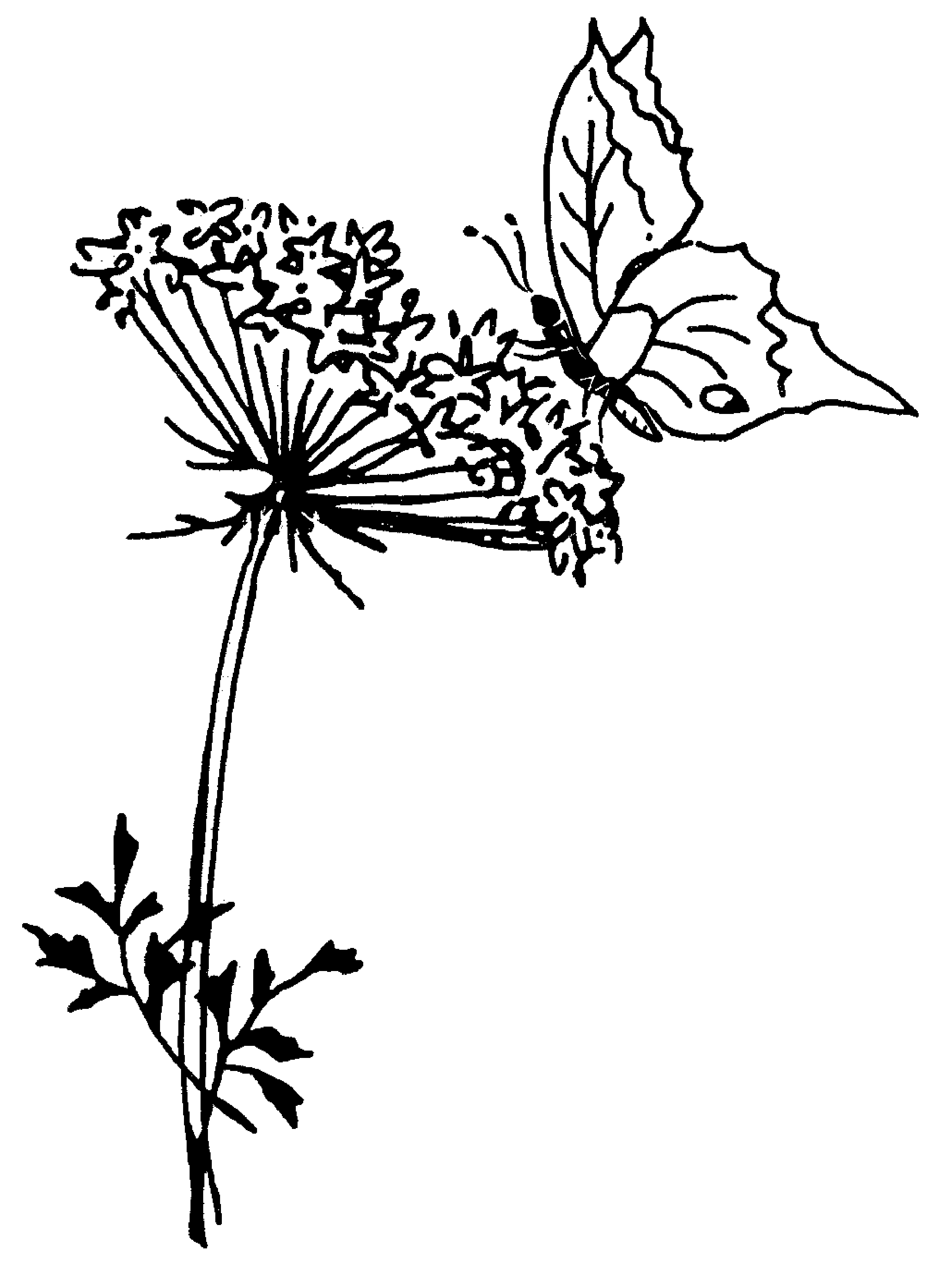Anbautipps für Weizenarten
Als Weizenarten werden eine Gruppe nah verwandter Getreide bezeichnet, zu der neben Weichweizen und Hartweizen unter anderem auch Einkorn, Emmer und Dinkel gehören. Weizen wird seit etwa 10.000 Jahren kultiviert und zählt heute nicht nur zu den wichtigsten Nahrungspflanzen, sondern gehört auch zu den bedeutendsten Weltwirtschaftspflanzen. Bei uns gibt es, abseits der in der Landwirtschaft dominierenden Intensivsorten des Weichweizens, einige Arten und Sorten, die im Hausgarten aus kulturgeschichtlichem Interesse, zur Zierde oder zur Selbstversorgung angebaut werden können.
Weizenarten anbauen
Der richtige Standort für Weizenarten
Weichweizen ist die anspruchsvollste der vier europäischen Hauptgetreidearten (Weizen, Gerste, Roggen, Hafer). Er verlangt einen tiefgründigen, nährstoffreichen Lehmboden. Dies gilt aber weniger für die älteren Weizenformen. In der Reihenfolge Dinkel, Emmer, Einkorn nehmen die Ansprüche an den Boden ab und die Genügsamkeit zu, ebenso zu den Wildformen hin.
Traditionell wurde Weizen in zweiter Tracht, d.h. nach gedüngten Hackfrüchten angebaut. Im Ökolandbau ist auch Kleegras oft die Vorfrucht. Eine zu reichliche Stickstoffversorgung führt aber gerade bei alten Sorten leicht zu Lager (Umfallen). Klimatisch sind alle Weizenformen in Mitteleuropa gut angepasst.
Weizenarten aussäen und anziehen
Weizen wird unterschieden in einjährige Sommerformen und einjährig überwinternde Winterformen. Winterweizen wird im Herbst gesät. Er verträgt feuchte Aussaatbedingungen relativ gut. Die Körner werden entweder gleichmäßig ausgestreut und eingeharkt oder in vorgezogene Reihen dicht ausgesät und mit dem Rechen mit Erde bedeckt. Eine dritte Möglichkeit ist die Horstsaat. Hierbei werden in 30 bis 40 cm Abstand nach allen Seiten jeweils drei bis fünf Korn 2 cm tief in die Erde gedrückt. Dies ist die sparsamste Variante. Für Sommerweizen sind die Saatverfahren die gleichen, die Aussaatzeit liegt dann im Frühling.
Weitere Pflege
Weizen braucht zunächst wenig Pflege. Bei Reihensaat kann im Herbst oder im Frühjahr gehackt werden, frühestens jedoch, wenn die Pflanzen drei Blätter ausgebildet haben. Bei Horstsaat ist das Hacken unbedingt zu empfehlen, damit die Pflanzen dann auch genug Platz haben um sich zu bestocken (mehrere Halme aus einer Pflanze) und einen geschlossenen Bestand bilden zu können.
Breitwürfig gesäte Weizen können anstelle der Hacke mit einem weitzinkigen Rechen oder einem Krail „gestriegelt“ werden. Kleine Beikrautkeimlinge werden dabei ausgerissen oder verschüttet, die Bestockung wird angeregt. Anders als auf größeren Feldern, wo sich die Halme bei Wind gegenseitig stützen, sollte Weizen im Hausgarten angebunden werden. Dies gilt insbesondere für die hochwüchsigen Sorten. Meist reicht es, Pfähle oder stabile Stäbe an die Ecken des Beetes zu stecken und das Getreide auf 2/3 seiner Höhe mit einer Schnur zu umgeben.
Weizenarten ernten und lagern
Wenn der Weizen seine grüne Farbe verliert und sich gelb färbt, durchläuft er mehrere Stufen der Reife, die sich durch Ausreiben einzelner Ähren und Zerbrechen der Körner prüfen lassen. Bei den bespelzten Formen müssen hierzu einige Körner aus den Spelzen gepult werden. In der „Milchreife“ sind die Körner noch grün und weich, ihr Inhalt ist milchig. Zum Zeitpunkt der „Teigreife“ sind die Körner bereits gelblich, ihr Inhalt ist teigig, lässt sich zwischen den Fingern zerkrümeln und schmiert dabei ein wenig. Es folgt die „Gelbreife“, bei der sich das Korn noch über den Daumennagel brechen lässt, der Korninhalt ist bereits trocken-mehlig. Danach kommt noch die „Totreife“: die Körner sind vollkommen hart und lassen sich nicht mehr brechen.
Während der Mähdrusch in der Landwirtschaft zum Zeitpunkt der Totreife erfolgt, kann der Weizen im Hausgarten wie zu alten Zeiten in der Gelbreife geschnitten werden: entweder kurz über dem Boden mit einer Sichel oder weiter oben mit der Gartenschere. Es geht auch ganz ohne Schneidwerkzeug: mit der Hand unterhalb der Ähre am Halm abwärtsfahren, bis zum obersten Halmknoten und den Halm über diesen Knoten brechen. Die Halme werden dann gebündelt zu „Garben“ und z.B. unter einem Dachvorsprung zum Nachtrocknen aufgehängt. Das „Dreschen“ geschieht bei kleinen Mengen am besten durch Ausreiben von Hand oder mit den Füßen (Schuhe mit sauberer Profilsohle). Größere Mengen werden auf dem Boden mit (Hasel-)Stöcken ausgeschlagen. Der viel schwerere Dreschflegel kann nur bei sehr großen Mengen zum Einsatz kommen, da er bei nicht ausreichender Schichthöhe des Strohs nicht federt, sondern auf den Boden durchschlägt und damit nicht gut ausdrischt, sondern die Körner zerschlägt.
Nach dem Drusch wird das Korn gereinigt. Von Hand ausgeriebene Körner ohne Spelzen können schon durch Abblasen der Spelzen weitgehend gereinigt werden. Beim Drusch größerer Mengen wird zunächst das Stroh weggeklaubt oder mit der (Mist-)Gabel ausgeschüttelt. Die Körner werden dann in eine Wanne oder eine große Schüssel gegeben und geschwenkt, so dass Strohbestandteile oben abgeschöpft werden können. Schließlich muss noch Wind zur Hilfe genommen werden, um Spelzen oder Grannen fortzublasen. Die trockenen Körner sind in mottendichten Behältnissen lange lagerbar. Die Keimfähigkeit hält drei bis fünf Jahre an.
Weizenarten verarbeiten und verwenden
Eine Verarbeitung zu Mehl kommt im Haushalt praktisch nur bei Nacktweizen infrage, da die Spelzweizen Einkorn, Emmer und Dinkel nicht ohne spezielle Vorrichtungen entspelzt werden können. Ihr Korn kann in begrenztem Umfang als Futter für Wiederkäuer oder Nagetiere, jedoch nicht für Geflügel, verwendet werden.
Das Schrot oder Mehl von Nacktweizen (Weichweizen T. aestivum und Rauweizen T. turgidum) kann für alle bekannten Backwaren verwendet werden.
Für feines Gebäck empfiehlt es sich, etwas Kleie im Küchensieb abzusieben. Diese kann dann z.B. wieder auf den Kuchenboden oder Pizzateig gestreut werden, wo sie beim Backen Saft vom Belag aufnimmt und am Ende doch ein Vollkornprodukt entsteht.
Wissenswertes
Der Ursprung des Weizens vor acht- bis zehntausend Jahren lag im sogenannten fruchtbaren Halbmond, im Gebiet der heutigen Länder Israel, Syrien, Jordanien, Irak und der Türkei. Über Griechenland gelangte er vor achttausend Jahren nach Europa. Wir bieten eine Weizenevolutionsreihe an.
Heute dominiert der Anbau von Weichweizen für die Herstellung von porenreichem, lockeren Gebäck. Ausschlaggebend für die Backqualität ist ein hoher Klebergehalt. Um diesen zu erreichen, wird intensiv mit hoher Stickstoffdüngung angebaut. Ein Teil des Klebers ist das Gluten. Ältere Weizensorten und extensiv angebaute Weizen enthalten weniger Gluten. Neben dem Weichweizen spielt vor allem der Durum (Hartweizen) eine bedeutende Rolle zur Pastaherstellung. Die alte Begrenzung des Weizenanbaus auf gute, „weizenfähige“ Böden ist seit den 1980er Jahren insofern aufgehoben, als dass auf ärmeren, sandigen Böden z.B. in der Lüneburger Heide (einem klassischen Roggenanbaugebiet) mit entsprechender Düngung und Bewässerung erfolgreich Weizen angebaut wird – in gewissem Sinne eine Annäherung an Hydrokultur.
Seit Langem wird versucht, Hybridsorten von Weizen auf den Markt zu bringen, die sich bisher aber nicht durchsetzen konnten. Aktuell wird in einem gigantischen, staatlich geförderten Forschungs- und Züchtungsprojekt ein neuer Anlauf dazu unternommen. Biologisch und ökologisch sinnvoll erscheint uns dieses Vorhaben nicht. Ein Durchbruch würde der Saatgutindustrie absehbar weitere Marktanteile bescheren.
Früher wurden Weizen und Dinkel und deren Produkte, allein oder in Verbindung mit anderen Pflanzen, vielfach als Heilmittel genutzt, insbesondere bei Hautkrankheiten, aber auch bei Erkrankungen des Verdauungssystems und vielen anderen.
Passendes Saatgut finden Sie hier:
Ihre Frage wurde nicht beantwortet oder Sie brauchen noch einen Rat?
Unser Gartentelefon hilft Ihnen gern weiter:
(Jan. bis Okt. Mittwoch 18-20 Uhr)